| Empört euch nicht! "Hetzjagd" und "Hexenkessel": Die Sprache von Journalisten bildet Wirklichkeit nicht nur ab, sie generiert sie auch. Ein Plädoyer für gewaltfreien Journalismus VON SUSANNE HEINRICH |
|
|
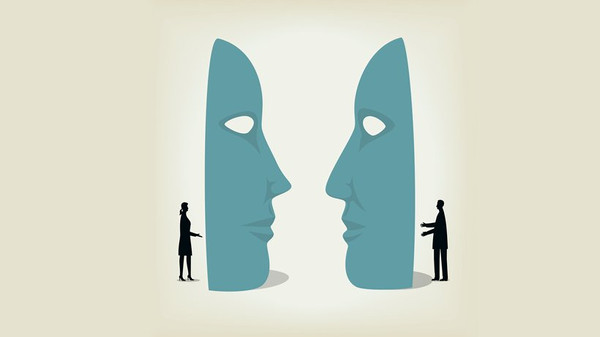 | | | Woher rührt nur die ganze Empörung? © dane_mark/Getty Images
|
In deutschsprachigen Medien ist von "Flüchtlingswellen" die Rede, die ein Land überrollen, von "Völkerwanderung" und davon, dass "der kleine Stolz, den man noch vor Kurzem empfinden konnte, ein Europäer zu sein, (...) mit Tausenden Männern, Frauen und Kindern im Mittelmeer ertrunken" sei. In der Debatte um die Fassade der Alice Salomon Hochschule mussten "Tugendterroristen" gestoppt werden, die Entfernung des Gedichts wurde zur "Inquisition" und zum Zeichen dafür, dass die "Demokratie in Ketten" liege. Die Politik der CSU ist ein "Angriff auf Europa" und der Anschlag auf Charlie Hebdo war sogar ein "Angriff auf die Zivilisation". Ob es in Chemnitz eine rechte "Hetzjagd" gegeben hat oder nur eine "Medienhetze gegen Rechts", wird heftig diskutiert. Seit ein paar Tagen ist "Chemnitz überall" und während vor ein paar Wochen noch vom "feministischen Volkssturm" die Rede war, spricht man heute vom "Bürgerkrieg in Sachsen" oder gar vom "Hexenkessel Deutschland". Man könnte die Wirkung solcher Metaphern als medialen Schock bezeichnen, in Anlehnung an den kleinen, wunderbaren Film Schlagworte – Schlagbilder von Harun Farocki, in dem er gemeinsam mit dem Medientheoretiker Vilém Flusser die Durchdringung von Wort und Bild im Boulevardjournalismus analysiert. Das trifft jedenfalls ziemlich gut, wie ich mich nach ausgiebigem Medienkonsum fühle: Ich bin in panischer Aufruhr. Ein Zustand, der, wie man auch ohne Psychologiekenntnisse weiß, das Denken blockiert, die Gefühle reduziert, das Erinnerungsvermögen behindert, kurz: die vernunftgebundenen menschlichen Fähigkeiten einschränkt. Ein Zustand also, in dem man nicht unbedingt handeln und schon gar keine wichtigen Entscheidungen treffen sollte. Das möchte ich aber, denn ich bin Künstlerin und Aktivistin. Und genau deswegen mische ich mich ein. Ich möchte beim Zigarettenkaufen am Zeitungskiosk nicht gern das Gefühl haben, dass die nächste Zigarette meine letzte vor der Apokalypse sein wird. Metaphern lösen Gefühle aus. Und diese wiederum haben einen ganz realen Effekt. Nehmen wir den obigen Beispielsatz , mit dessen politischer Haltung ich sogar sympathisiere: "Der kleine Stolz, den man noch vor Kurzem empfinden konnte, ein Europäer zu sein, er ist zusammen mit Tausenden Männern, Frauen und Kindern im Mittelmeer ertrunken." Was macht es mit mir, diesen Satz zu lesen? Ich sehe ertrinkende Menschen, ein untergehendes Europa. Ich fühle Scham, Handlungsunfähigkeit, Verzweiflung. Mein Verstand ist blockiert. Erst viel später werde ich stutzig. Warum habe ich mich beim Lesen fast selbst wie eine Ertrinkende gefühlt? Schließlich habe ich das ungerechte Glück, nicht in einem untergehenden Boot zu sitzen. Der Linguist George Lakoff schreibt über die Berichterstattung zum Irakkrieg: " Metaphern können töten ." Ist das nicht selbst schon wieder eine, frage ich mich, und sehe vor mir eine Metapher mit gefletschten Zähnen. Sagen wir es anders, sagen wir: Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab oder übersetzt sie, sie generiert auch Wirklichkeit. Da sind sich Hirnforscher*innen, Linguist*innen, Kognitionswissenschaftler*innen und Psycholog*innen einig. Wer beispielsweise immer noch nicht glaubt, dass das sogenannte generische Maskulinum eine Fiktion ist, könnte die wissenschaftlichen Studien lesen. Denn sie zeigen, dass ein generisches Maskulinum aus psycholinguistischer Sicht nicht existiert, weil wir grammatisch maskuline Formen deutlich häufiger auf Männer beziehen, bei dem Begriff Ärzte also nicht automatisch weibliche Berufsgenossinnen mitdenken – was wiederum Einfluss darauf hat, wo Frauen* ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Darüber könnte man sachlich diskutieren. Stattdessen ist im Zusammenhang mit geschlechtergerechter Sprache von "demokratischer Pflicht" die Rede oder aber von "Zensur" und "verhunzter Sprache". Ich sehe vor meinem inneren Auge lauter wahnsinnig gewordene Hysterikerinnen mit Gewehren, Flinten und Panzerfäusten durch eine verwüstete Landschaft auf den armen "bedrohten Mann" zustürmen. Manchmal gehen Metaphern so weit, dass sie sogar die Tatsachen verdrehen und real existierende Machtverhältnisse umkehren – so zum Beispiel, wenn im oben zitierten Artikel vom "Triumph des totalitären Feminismus" die Rede ist, obwohl der Feminismus nie eine dominierende politische Strömung war und seine Ziele keineswegs umgesetzt wurden. Der Ton der Debatte wird hysterisch. Wann ist das – Achtung, Metapher! – aus dem Ruder gelaufen? Eine Ursache für diese Entwicklung liegt sicherlich darin, dass politische Akteure sowohl auf der rechten wie auch der linken Seite des politischen Spektrums seit etlichen Jahren zunehmend offensiver Sprachpolitik betreiben. Die beliebteste rhetorische Figur von rechtspopulistischen Politiker*innen ist wohl diese: Erst wird mit einer doppeldeutigen oder entkontextualisierten Aussage provoziert. Beispiel: Björn Höckes Rede über die Erinnerungskultur. "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Wie von ihm vermutlich erwartet, reagieren manche Medienvertreter heftig auf die Äußerung. Höcke rudert zurück, mit einer Geste der Selbstviktimisierung , deren Subtext ist: "Wieder hat die Lügenpresse mich falsch verstanden. Dabei habe ich es doch gar nicht so gemeint." So hat er sich gleich noch mal mehr Raum genommen, um die ganze unterdrückte Wahrheit märtyrerhaft ans Licht zu holen. Scheinen nur noch Streit und Diffamierung möglich? Doch nicht nur die Rechten machen Sprachpolitik, Sprachpolitik ist auch der Hauptschauplatz queerfeministischer Kämpfe. Dieser aktuell weit verbreitete Feminismus, der sich auf Judith Butler und ihre Theorie der "heteronormativen Matrix" beruft, kämpft für die Anerkennung und Sichtbarmachung verschiedener Lebensrealitäten. Moralisch richtig zu handeln, bedeutet nach dekonstruktivistischer Logik letztlich vor allem, richtig zu sprechen. Das erklärt, warum Queerfeminist*innen immer wieder dadurch auffallen, dass sie andere Menschen korrigieren, auf Kränkungen hinweisen und einen hohen Anspruch an sich und andere haben. Gerade dieser Anspruch wird dann oft als Demonstration moralischer Überlegenheit empfunden und provoziert, bewusst oder unbewusst, Abwehrgefühle und Gegenschläge wie etwa den populären Vorwurf, linke Identitätspolitiken seien schuld am Erstarken der Rechten. Und schon gibt es wieder Schuldige. Alle Seiten scheinen permanent nach einem Schuldigen zu suchen und wie im Beispiel der Debatte um die Fassade der Alice Salomon Hochschule machen manche Journalist*innen mit. Was kann aber helfen, wenn die Gesprächskultur kaputt ist und die Fronten so verhärtet sind, dass nur noch Streit und Diffamierung möglich scheinen? Es nicht nur in der politischen Debatte, sondern auch im Journalismus kein Entkommen mehr vor dem sprachlichen Dauerexzess gibt? Ein Vorschlag: Probieren wir es mit gewaltfreier Kommunikation (GFK). Sie wurde schon seit Langem in politischen Kontexten eingesetzt, etwa in Krisengesprächen zwischen Israel und Palästina. Dabei geht es um die Frage, wie Äußerungen – egal wie unlogisch, übergriffig, verkorkst oder brutal sie uns vorkommen mögen – sich so hören lassen, dass Mensch mit den dahinter liegenden Bedürfnissen des anderen in Kontakt kommt? Marshall B. Rosenbergs großes Stichwort ist Empathie. Für den Psychologen und Begründer der GFK ist letztlich auch eine Schlägerei nur eine (hilflose) Äußerung eines Bedürfnisses. Wie wir diese Situation einordnen, verarbeiten und beantworten, liegt in unserer Verantwortung. Um Gewalt nicht zu reproduzieren, empfiehlt Rosenberg, auf "lebensentfremdende" Kommunikation zu verzichten: keine moralischen Urteile, keine Vergleiche, kein Übertragen von Verantwortung auf andere. Rosenberg geht sogar noch weiter. Er empfiehlt, gänzlich auf Analysen von Handlungen zu verzichten: "Es ist meine Überzeugung, dass diese ganzen Analysen des Verhaltens anderer Menschen tragischer Ausdruck unserer eigenen Werte und Bedürfnisse sind." Das klingt als Reformvorschlag für einen anderen Journalismus sicher erst einmal befremdlich. Denn geht es nicht genau um Analyse? Geht es nicht darum, einzuordnen, zu kontextualisieren, zu bewerten, die Dinge klar beim Namen zu nennen? Wo kämen wir denn hin, wenn wir bestimmte Äußerungen nicht mehr als falsch und unrecht labeln würden? Ja, wo kämen wir da hin? Das frage ich mich ernsthaft. Bestimmt in unsichere Gefilde. Bestimmt auch runter von den verschieden hohen Rössern. Vielleicht könnte man das ausprobieren. Schließlich funktioniert das andere Extrem – sprachliche Aufrüstung und strenge moralische Verurteilung – gerade nicht sonderlich gut. Starke Gefühle sind erst mal da Selbst wenn das Ziel im Journalismus letztlich nicht sein kann, sich jeglicher Bewertung zu enthalten, könnte man von der GFK lernen, Beobachtungen, Gefühle und Bewertungen zu trennen und Urteile immer im Rückbezug auf eigene als solche ausgewiesene Werte zu fällen, die eben nicht als universal vorauszusetzen sind oder normativ gesetzt werden. Also beispielsweise auszuweisen, welches Bedürfnis der Rede von einem "Angriff" auf unsere Zivilisation, dem Bild der "Völkerwanderung" oder dem Vorwurf der "Inquisition" zugrunde liegt. Viele Mischformen, die derzeit existieren, wie etwa aus einer Kränkung heraus versuchte Strukturanalysen oder als Vorwürfe formulierte Ängste, würde die GFK als eher aussichtslose Kommunikationsversuche werten – vorausgesetzt es geht überhaupt darum, gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass Beobachtungen, die mit einer Bewertung verknüpft sind, als Kritik gehört werden. Die wiederum blockiert – wie auch das Formulieren von Forderungen – die Einfühlsamkeit. Und ich glaube, dass es davon gerade besonders viel bräuchte. Ich korrigiere mich: Ich wünsche mir davon mehr. Das geht in die entgegengesetzte Richtung als das, worin andere eine Lösung für die gewaltvolle Metaphorik mancher Artikel erkennen: auf Emotionen zu verzichten, die Debatte abzukühlen und nur Argumente sprechen zu lassen. Die GFK legt das Gegenteil nahe, nämlich Argumente zugunsten der dahinter liegenden Bedürfnisse zunächst zu vernachlässigen. Das geht mit der Gefahr einher, strukturelle Gewalt tendenziell unsichtbar zu machen. Es fällt mir selbst wahnsinnig schwer, Begriffe wie den des patriarchalen Kapitalismus nicht zu benutzen, weil es mir geholfen hat, vielen meiner Gefühle und Erlebnisse einen Sinn zuzuschreiben. Trotzdem möchte ich hin und wieder versuchen, das zu tun. Und zwar, um im Gespräch zu bleiben mit all jenen, die ich als potenzielle Verbündete für verschiedene Kämpfe nicht aufgeben will. Wenn Harald Welzer in einem Editorial der Zeitschrift taz Futurzwei (für die ich hin und wieder selbst schreibe) im Zusammenhang mit dem Fassadenstreit an der Alice Salomon Schule von "stalinistischen" Linken spricht, ohne dieses starke Urteil mit seinen Werten zu verknüpfen, und wenn er nicht gleichzeitig dazusagt, dass er mit vielen Absichten des Feminismus eigentlich einverstanden ist, bin ich versucht, mich ebenfalls zu identifizieren und zu positionieren. Ich fühle mich verletzt und die Drastik der Bemerkung weckt in mir die Lust nach einem rhetorischen Gegenschlag. Das wiederum macht mir Angst, denn es entfernt uns voneinander – dabei sind wir uns politisch in vielen Dingen ziemlich einig. Woher kommt diese Empörung überhaupt? Starke Gefühle sind Hinweise auf die Füllstände unserer Bedürfnisse, heißt es in der GFK. Vor allem aber sind sie erst mal da – auf allen Seiten. Und dass unterdrückte und fehlgeleitete Gefühle uns teuer zu stehen kommen, wissen wir als narzisstische Gesellschaft eigentlich. Warum also nicht gleich mit ihnen arbeiten und versuchen, an die dahinter liegenden, oft unbewussten Bedürfnisse ranzukommen? Hinter diesem Text, der sicher an einigen Stellen seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt und als erste Übung zu verstehen ist, steht unter anderem mein Bedürfnis nach mehr Resonanz. Ich wünsche mir eine Atmosphäre wohlwollender Zugewandtheit, um in ehrlichen Kontakt (auch Streit) miteinander treten zu können. Ich glaube, dass es dafür notwendig wäre, den Kampf um die Deutungshoheit aufzugeben. Statt Begriffe zu claimen und zu re-claimen, wünsche ich mir einen offeneren Umgang mit den Fragen, wer wie wofür oder für wen und aus welchen Gründen argumentiert. Das hätte vielleicht den angenehmen Nebeneffekt, dass Debatten weniger heuchlerisch geführt würden. Und vielleicht wären auf einer solchen Basis dann auch wieder konstruktive Strukturanalysen möglich – ohne die es, wie ich finde, eben auch nicht geht. Die eigenen Werte und Bedürfnisse explizit zu thematisieren würde den Journalismus übrigens nicht unbedingt gefühliger machen. Ich glaube, es würde ihn reicher, vielschichtiger und amüsanter machen. Wahrscheinlich würden einige Kommentare und Artikel über das Ende der europäischen Moral entfallen, da von ihnen, würde man die rechtschaffene Empörung herauskürzen, nichts übrig bliebe. Es würden vielleicht ein paar reumütige Artikel zur Alice-Salomon-Debatte folgen, in denen Journalist*innen zugeben, überreagiert zu haben, und erzählen, was sie aus dem Fall gelernt haben. Vielleicht würde der eine oder andere Artikel die eigene strukturelle Bigotterie thematisieren, zum Beispiel wenn eine feministische Position im Text mit der sexistischen Werbeanzeige daneben erkauft wurde. Und ich könnte beim Lesen endlich wieder schmunzelnd oder wütend eine Zigarette rauchen, ohne mich dem Gefühl der nahenden Apokalypse auszuliefern. Susanne Heinrich hat nach vier Büchern bei DuMont noch einmal studiert: Filmregie. Ihr Debütfilm "Das melancholische Mädchen" feiert bald Premiere. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8".
Sie wollen der Diskussion unter dem Text folgen? Hier geht es zum Kommentarbereich. |
|
|
Frauen schreiben jetzt auch abends. Montags, mittwochs, freitags. Immer um 10 nach 8. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnen-Kollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht.
Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Auf dieser Seite sammeln wir alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. |
|
|
|
|
|